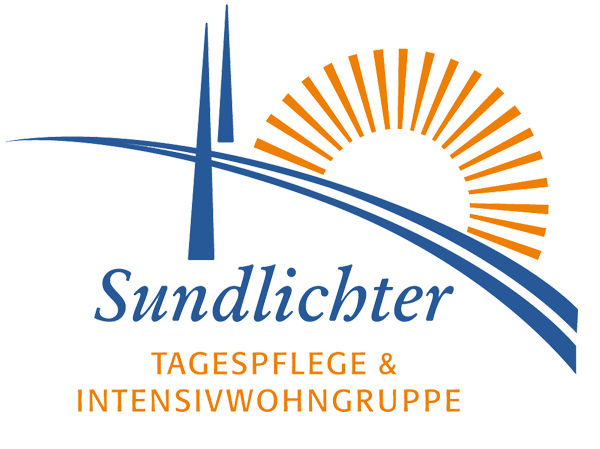Wer hat Anspruch auf ambulante Pflegeleistungen?
Pflegeleistungen in Deutschland: Wer hat Anspruch und welche Voraussetzungen gelten?
Die Pflegeversicherung in Deutschland ist als Sozialversicherung konzipiert und soll Menschen bei Pflegebedürftigkeit finanziell unterstützen. Seit ihrer Einführung 1995 hat sie sich zu einem wichtigen Baustein der sozialen Sicherung entwickelt. Doch nicht jeder, der sich alt oder gebrechlich fühlt, hat automatisch Anspruch auf Pflegeleistungen. Die Berechtigung ist an konkrete Voraussetzungen geknüpft, die durch ein standardisiertes Begutachtungsverfahren ermittelt werden. Das Verständnis dieser Kriterien ist entscheidend für alle, die für sich selbst oder ihre Angehörigen Pflegeleistungen beantragen möchten.
Grundlegende Voraussetzungen für den Anspruch
Der Anspruch auf Pflegeleistungen in Deutschland setzt zunächst voraus, dass die betroffene Person in der Pflegeversicherung versichert ist. Dies erfolgt automatisch für alle gesetzlich Krankenversicherten, während privat Krankenversicherte eine separate private Pflegepflichtversicherung abschließen müssen. Eine weitere Grundvoraussetzung ist die Wartezeit von zwei Jahren, das bedeutet, dass die Person mindestens zwei Jahre vor Antragstellung in der Pflegeversicherung versichert gewesen sein muss. Ausnahmen gelten für Kinder unter 25 Jahren, für die diese Wartezeit nicht gilt, sowie für Menschen, die durch Arbeitsunfälle oder Berufskrankheiten pflegebedürftig werden.
Die zentrale Voraussetzung ist jedoch das Vorliegen einer Pflegebedürftigkeit im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes. Pflegebedürftig sind Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen. Diese Beeinträchtigungen müssen auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, bestehen. Vorübergehende Hilfebedarfe, etwa nach Operationen oder bei kurzen Krankheitsphasen, begründen keinen Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung.
Das Begutachtungsverfahren und die Pflegegrade
Ob eine Person pflegebedürftig ist und welcher Pflegegrad vorliegt, wird durch eine Begutachtung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) bei gesetzlich Versicherten oder durch MEDICPROOF bei privat Versicherten festgestellt. Das Begutachtungsverfahren folgt einem standardisierten System, das die Selbstständigkeit in sechs verschiedenen Bereichen bewertet. Dazu gehören Mobilität, kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen und psychische Problemlagen, Selbstversorgung, Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen sowie die Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte.
Die Bewertung erfolgt in Punkten, wobei je nach Schwere der Beeinträchtigung unterschiedliche Punkte vergeben werden. Aus der Gesamtpunktzahl ergibt sich einer von fünf Pflegegraden. Pflegegrad 1 entspricht einer geringen Beeinträchtigung der Selbstständigkeit, während Pflegegrad 5 die schwerste Beeinträchtigung mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung darstellt. Jeder Pflegegrad ist mit unterschiedlichen Leistungsansprüchen verbunden, wobei die Leistungen mit steigendem Pflegegrad zunehmen.
Besondere Personengruppen und ihre Ansprüche
Bestimmte Personengruppen haben besondere Regelungen beim Zugang zu Pflegeleistungen. Kinder und Jugendliche werden nach altersspezifischen Kriterien begutachtet, da ihre Entwicklung berücksichtigt werden muss. Hier wird verglichen, inwieweit die Selbstständigkeit und die Fähigkeiten gegenüber einem gesunden gleichaltrigen Kind beeinträchtigt sind. Menschen mit Behinderungen, die bereits Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten, können zusätzlich Pflegeleistungen beanspruchen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind.
Auch Menschen mit psychischen Erkrankungen oder dementiellen Veränderungen haben seit der Pflegereform 2017 deutlich bessere Chancen auf Pflegeleistungen. Das neue Begutachtungsverfahren berücksichtigt nicht nur körperliche, sondern auch kognitive und psychische Beeinträchtigungen gleichwertig. Dies hat dazu geführt, dass viele Menschen mit Demenz, die früher keine oder nur geringe Leistungen erhielten, nun angemessen versorgt werden können.
Antragstellung und zeitliche Aspekte
Der Anspruch auf Pflegeleistungen entsteht nicht automatisch, sondern muss bei der zuständigen Pflegekasse beantragt werden. Dies kann formlos erfolgen, oft reicht bereits ein Telefonat oder ein formloses Schreiben. Wichtig ist das Datum der Antragstellung, da Leistungen frühestens ab dem Monat der Antragstellung gewährt werden, nicht rückwirkend ab Beginn der Pflegebedürftigkeit.
Nach Eingang des Antrags ist die Pflegekasse verpflichtet, innerhalb bestimmter Fristen eine Begutachtung zu veranlassen. Bei Antragstellern im Krankenhaus oder in stationären Rehabilitationseinrichtungen beträgt die Frist eine Woche, bei Menschen in häuslicher Umgebung fünf Wochen. Wird diese Frist überschritten, kann der Antragsteller pro Woche der Verzögerung 70 Euro Schadenersatz verlangen.
Leistungsarten und deren Voraussetzungen
Je nach Pflegegrad und individueller Situation können verschiedene Leistungsarten beansprucht werden. Pflegegeld wird bei häuslicher Pflege durch Angehörige oder andere nicht-professionelle Pflegepersonen gewährt, während Pflegesachleistungen die Versorgung durch einen professionellen ambulanten Pflegedienst ermöglichen. Beide Leistungsarten können auch kombiniert werden. Für die Tagespflege, Nachtpflege, Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege gelten spezielle Voraussetzungen, die meist eine bereits bestehende häusliche Pflegesituation erfordern.
Menschen mit Pflegegrad 1 haben keinen Anspruch auf Pflegegeld oder Pflegesachleistungen, erhalten jedoch Unterstützung durch den monatlichen Entlastungsbetrag von 125 Euro sowie Zuschüsse für Pflegehilfsmittel und Wohnraumanpassungen. Bei vollstationärer Pflege übernimmt die Pflegeversicherung je nach Pflegegrad unterschiedlich hohe Anteile der Pflegekosten, wobei die Bewohner einen Eigenanteil tragen müssen.
Die Pflegeversicherung in Deutschland ist als Teilkaskoversicherung konzipiert und deckt nicht alle Kosten ab. Sie soll jedoch eine Grundversorgung sicherstellen und Familien bei der Bewältigung der finanziellen Belastungen unterstützen, die durch Pflegebedürftigkeit entstehen.